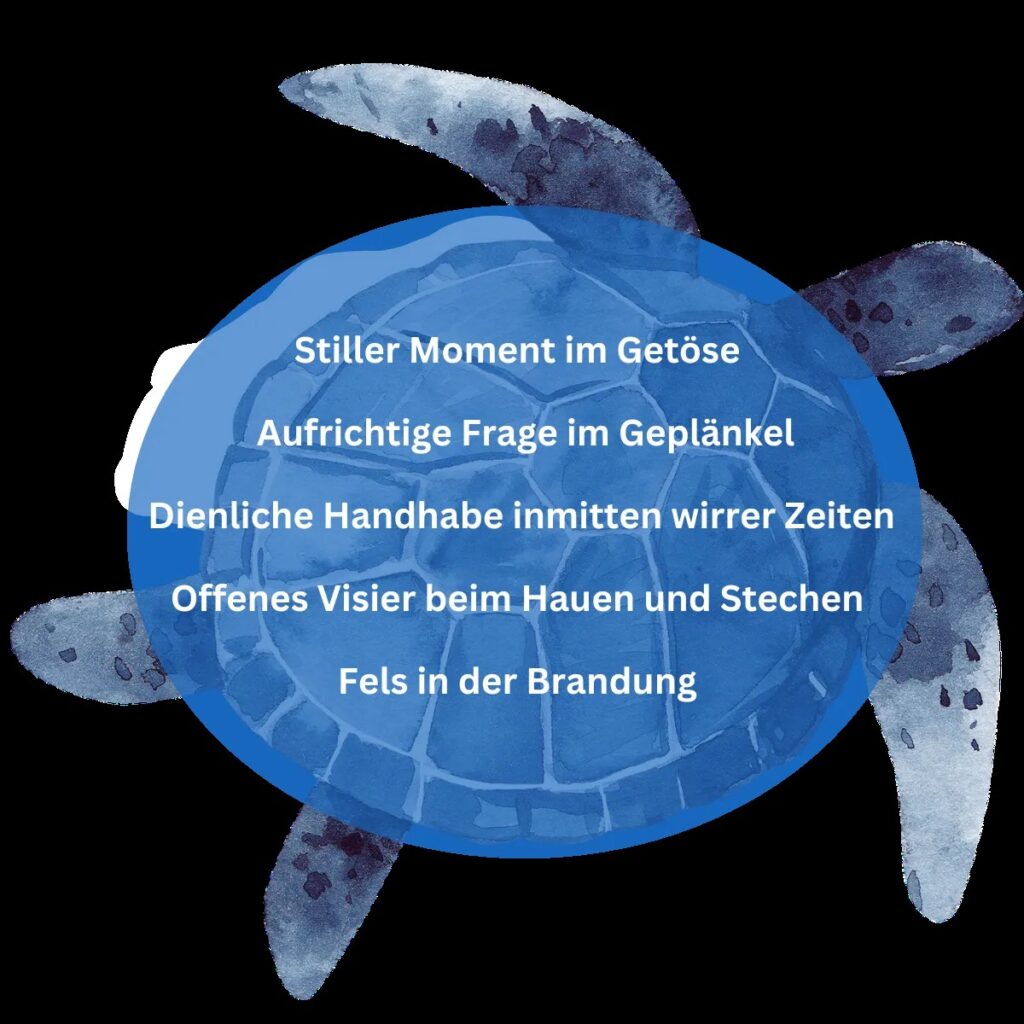In diesem vorerst letzten von insgesamt 4 Beiträgen zu meiner Veto-Weiterbildung in 2024 geht es um Schildkröten. Falls dich das irritiert, liegt es vielleicht daran, dass du den vorhergehenden Artikel über die Statussymboltiere noch nicht gelesen hast. Führe ihn dir gerne zu Gemüte, damit du den folgenden Inhalt besser einordnen kannst!
Schildkröten gelten in vielen Kulturen als Symbol für ein langes Leben sowie für Geduld und Weisheit. Manche sehen in ihnen auch ein Symbol für das Vergehen der Zeit an sich. Als ich mit meinen großen Kindern im Sommer in Albanien war, gab es immer großes Hallo, wenn es plötzlich im Gebüsch raschelte und eine Landschildkröte daraus hervorkrabbelte – meistens zielstrebig und unbeirrt auf dem Weg zu einem Ziel, das wohl nur sie selber kannte.
Aber was verkörpert die Schildkröte als Symbol für Führungsstile oder pädagogische Handlungsmuster?
Wir haben es hier mit einem Wesen tun, das sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne in sich zu Hause ist! Während die im vorhergehenden Artikel beschriebenen Statustypen Löwe, Kläffer und Erdmännchen letztlich das Ergebnis unterschiedlicher Formen autoritärer Prägung in der Kindheit sind, stellt Typ Schildkröte gewissermaßen das Entwicklungsziel dar, welchem sich entwicklungsbereite Menschen durch bewusste Selbstreflexion, Training und mutig-spielerisches Experimentieren immer mehr anverwandeln können.
Aus Sicht der von Maike Plath entwickelten Status-Typologie steht die Schildkröte für inneren Hochstatus in Kombination mit äußerem Tiefstatus. Innerer Hochstatus deshalb, weil sie …
- sich und ihre Grenzen gut kennt und sie mit ihrem eigenen Gefühlsleben vertraut ist.
- die Höhen und Tiefen des Lebens prinzipiell als wertvolle Lernerfahrungen sehen kann.
- dadurch letztendlich einen gesunden Selbstwert sowie ein bemerkenswertes Gefühl für Integrität entwickeln konnte.
Auch der Löwe als Statustyp, wenn du dich erinnerst, nimmt inneren Hochstatus ein – im Unterschied zur Schildkröte jedoch auf eine oberflächlichere Art und Weise: Er ist einfach überzeugt von seinen Fähigkeiten und seiner Macht und findet sich supertoll – was jedoch nicht unbedingt heißt, dass er sich gut reflektieren kann und mit seinem eigenen Innenleben vertraut ist.
Aber was hat es mit „nach außen tief“ auf sich?
Auch Statustyp Erdmännchen praktiziert äußeren Tiefstatus und Konflikt vermeidendes Verhalten – allerdings infolge von Konditionierung im Sinne einer kindlichen Überlebensstrategie – oder drastisch ausgedrückt: als eine Art Zwangsreaktion, getrieben von Angst vor Eskalation, Beziehungsabbruch oder sozialer Ausgrenzung. Typ Schildkröte entscheidet sich für Tiefstatus und Deeskalation – nicht weil sie es muss, sondern weil sie es kann!
Soll heißen: Sie kann, wenn es darauf ankommt, auch anders.
Z.B. kann es in der Begegnung mit Typ Löwe notwendig werden, ganz klar Grenzen zu setzen oder gar auf eine durchaus aggressive Form der Selbstbehauptung zurückzugreifen – um am Ende überhaupt wahr- bzw. ernst genommen zu werden! Diesen Aspekt berücksichtigend, müsste es bei Typ Schildkröte genau genommen heißen: außen tief zu 90 %, d.h. in circa 90 % der Fälle – abhängig jeweils von der konkreten Situation.
Vielleicht wird an dieser Stelle deutlich, was das „außen tief“ der Schildkröte in der Konsequenz bedeutet: Um sich für deeskalierendes Agieren im Tiefstatus frei entscheiden zu können, anstatt aus einem in der Kindheit erlernten Handlungsmuster heraus zu reagieren, kann es ziemlich hilfreich sein, wenn Mensch die gesamte Skala zwischen Anpassung und Selbstbehauptung kennt und bespielen kann!
Die Betonung liegt dabei auf „spielen“.
Das führt mich zur Veto-Weiterbildung, welche ich im vergangenen Jahr durchlaufen durfte. Diese Erfahrung beeinflusst meine Seminare, Kreisdialoge, Coachings und natürlich auch meinen persönlichen Alltag in der Weise, dass Qualitäten wie Eigenverantwortung, Würde und Integrität mittlerweile einen spürbar höheren Stellenwert innehaben.
Im ersten Modul ging es darum, mit Methoden aus der Biografiearbeit meine eigene autoritäre Prägung genauer zu erkunden und zu verstehen, wie diese meine heutigen Verhaltensmuster bestimmen – und welchen Preis das mich und meine lieben Mitmenschen mitunter kostet. In der in Modul 2 daran anschließenden, weitgehend theatralen Auseinandersetzung mit Hoch- und Tiefstatus sowie den Kollegen Löwe/Kläffer/Erdmänchen wurde es extrem spielerisch …
… und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen:
Wenn ich diese Konditionierungen bei mir und anderen erkenne, kann ich bewusst auch einen ganz anderen Status einnehmen, kann ich bewusst bestimmte Punkte auf allerhand Skalen einnehmen – bspw. zwischen „totaler Anpassung“ und „wütend alles abfackeln“ – oder zwischen „mich ängstlich tot stellen“ und „ich drehe vor Publikum mal so richtig auf“. Der Clou dabei: Den nervigen, immer wiederkehrenden und immer wieder sich selbst reproduzierenden Interaktionsmustern innerhalb meines Alltags mal einen ganz neuen Drive geben!
Fetzt, oder? Birgt jedoch auch Herausforderungen, weil mitunter tiefer gelegte – wollt´sagen tiefer liegende Ängste und andere starke Emotionen getriggert werden können!
Deshalb ging es im Modul 3 um „Schattenarbeit“:
- Was genau stört mich eigentlich an Verhaltensweisen spezieller Zeitgenoss:innen?
- Warum werden da Emotionen in einem Maße angetriggert, welches irgendwie in keinem angemessenen Verhältnis mit dem betreffenden Verhalten zu stehen scheint?
- Und: Was würde passieren, wenn ich mir, sagen wir mal, 5-10 % davon probehalber zu eigen machen würde?
Das Schöne an diesem eigentlich ziemlich in die Tiefe führenden Modul war, dass wir eben nicht den größten Teil der Zeit im Kreis saßen und redeten, sondern uns spielerisch auf all die reizenden Charaktere stürzten, die uns triggern – und exzessiv und lustvoll in ihren Eigenschaften und Allüren „badeten“!
Danach biste geheilt, eh!
Modul 4 nahm nochmal explizit Konflikte in den Fokus: Alle Statustypen, alle Skalen einfach mal durchspielen anhand von Situationen, die im Alltag SO SEHR wehtun können – und immer öfter mal den Schildkrötenstyle erproben. Letzerer wurde im fünften und letzten Modul dann nochmal richtig zelebriert.